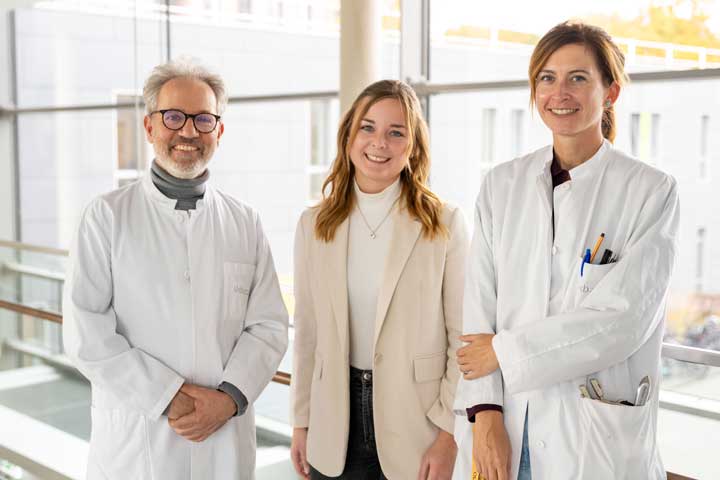Kombination zweier Blutmarker verbessert Diagnosegenauigkeit bei ALS
Neue Forschung zeigt: Kombination aus sNfL und cTnT ermöglicht genauere Unterscheidung zwischen ALS und anderen neurodegenerativen Erkrankungen
Bonn, 28. Oktober 2025 – Die Diagnose der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) bleibt trotz moderner Bildgebung und genetischer Tests eine Herausforderung, insbesondere bei der Abgrenzung zu klinisch ähnlichen neurodegenerativen Erkrankungen. Eine neue Studie unter Federführung des Universitätsklinikums Bonn (UKB) in Kooperation mit dem Alfried Krupp Krankenhaus Essen zeigt nun, dass die Kombination zweier Blut-Biomarker – Neurofilament-Leichtketten (sNfL) und kardiales Troponin T (cTnT) – die diagnostische Genauigkeit bei ALS signifikant erhöht. Die Studienergebnisse sind jetzt in der Fachzeitschrift „Annals of Neurology“ veröffentlicht.
Kombination als diagnostischer Vorteil
Während sNfL bereits als etablierter Marker für neuroaxonale Schädigung gilt, ist es nicht spezifisch für ALS. cTnT hingegen, ein klassischer Herzmarker, zeigt bei ALS-Patient*innen aufgrund muskelspezifischer Veränderungen ebenfalls erhöhte Werte – jedoch ohne Herzpathologie. In der vorliegenden Studie wurde der diagnostische Wert beider Marker sowohl einzeln als auch in Kombination untersucht.
Studiendesign und Ergebnisse
Insgesamt wurden retrospektiv Daten von 293 ALS-Patient*innen mit 85 Patient*innen mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen sowie 29 gesunden Kontrollpersonen verglichen. Zusätzlich validierte eine unabhängige Kohorte von 501 ALS-Patient*innen die Ergebnisse.
Die Auswertung mittels ROC-Kurvenanalyse ergab, dass die kombinierte Biomarkerstrategie die Trennschärfe gegenüber anderen Erkrankungen deutlich verbessert – ein entscheidender Fortschritt für die Frühdiagnostik.
ALS-spezifischer Grenzwert für cTnT identifiziert
Ein weiterer Befund der Studie ist die Festlegung eines ALS-spezifischen Schwellenwerts für cTnT bei 8,35 ng/L – deutlich unter dem etablierten kardiologischen Grenzwert (14 ng/L). Mit diesem angepassten Cut-off konnte die Sensitivität der ALS-Diagnostik weiter gesteigert und zusätzliche Betroffene korrekt identifiziert werden.
Prognostischer Mehrwert
Die Studie zeigt zudem, dass ALS-Patient*innen mit unauffälligen Biomarkerwerten („biomarker-negativ“) deutlich langsamere Krankheitsverläufe aufweisen als „biomarker-positive“ Patient*innen. Bei den Studienteilnehmenden lag die mittlere Krankheitsdauer der biomarker-negativen Gruppe bei 73 Monaten gegenüber 18 Monaten in der biomarker-positiven Gruppe. Auch die Krankheitsprogression verlief signifikant langsamer.
Fazit
„Unsere Ergebnisse belegen, dass die Kombination von sNfL und cTnT die diagnostische Genauigkeit bei ALS erhöht und darüber hinaus wertvolle Hinweise auf den Krankheitsverlauf geben kann“, sagt PD Dr. Patrick Weydt, Leiter Ambulanz für ALS und andere Motoneuronerkrankungen am UKB. Der Studienleiter forscht auch an der Universität Bonn. „Gerade im klinischen Alltag ist es entscheidend, ALS frühzeitig und zuverlässig von anderen neurologischen Erkrankungen abgrenzen zu können. Die Kombination aus sNfL und cTnT bietet hier einen echten diagnostischen Mehrwert – und das mit etablierten, routinetauglichen Labormethoden“, ergänzt Dr. Torsten Grehl, Zentrum für ALS und andere Motoneuronerkrankungen vom Alfried Krupp Krankenhaus Essen. Die duale Markerstrategie könnte künftig helfen, ALS früher und sicherer zu diagnostizieren – und Subgruppen mit unterschiedlicher Prognose zu identifizieren. Die Erkenntnisse würden somit neue Perspektiven für die personalisierte ALS-Diagnostik und -Therapieentwicklung bieten.
Beteiligte Institutionen: Neben UKB, der Universität Bonn und DZNE waren das Alfried Krupp Krankenhaus in Essen und die Charité – Universitätsmedizin in Berlin sowie die Ambulanzpartner Soziotechnologie APST GmbH in Berlin an der Studie beteiligt.
Publikation: Paula Lindenborn et al.: Combination of serum neurofilament light chain and serum cardiac troponin T as biomarkers improves diagnostic accuracy in amyotrophic lateral sclerosis; Annals of Neurology; https://doi.org/10.1002/ana.78066.
Wissenschaftlicher Kontakt:
PD Dr. Patrick Weydt
Klinik für Neuromuskuläre Erkrankungen
Venusberg-Campus 1, Zone Süd, NPP (Gebäude 80)
53127 Bonn, Deutschland
Telefon: (+49) 0228 287-13775
E-Mail: patrick.weydt@ukbonn.de
Bildmaterial
Bildunterschrift (v. l.): UKB-Forschungsteam um Dr. Patrick Weydt, Paula Lindenborn und Dr. Sarah Bernsen entdeckt: Kombination aus zwei Blutmarkern erhöht Diagnosegenauigkeit bei ALS.
Bildnachweis: Universitätsklinikum Bonn / A. Winkler
Pressekontakt:
Daria Siverina
stellv. Pressesprecherin am Universitätsklinikum Bonn (UKB)
Stabsstelle Kommunikation und Medien am Universitätsklinikum Bonn
Telefon: (+49) 0228 287-14416
E-Mail: daria.siverina@ukbonn.de
Zum Universitätsklinikum Bonn: Als eines der leistungsstärksten Universitätsklinika Deutschlands verbindet das UKB Höchstleistungen in Medizin und Forschung mit exzellenter Lehre. Jährlich werden am UKB über eine halbe Million Patienten ambulant und stationär versorgt. Hier studieren rund 3.500 Menschen Medizin und Zahnmedizin, zudem werden jährlich über 600 Personen in Gesundheitsberufen ausgebildet. Mit rund 9.900 Beschäftigten ist das UKB der drittgrößte Arbeitgeber in der Region Bonn/Rhein-Sieg. In der Focus-Klinikliste belegt das UKB Platz 1 unter den Universitätsklinika in NRW und weist unter den Universitätsklinika bundesweit den zweithöchsten Case-Mix-Index (Fallschweregrad) auf. 2024 konnte das UKB knapp 100 Mio. € an Drittmitteln für Forschung, Entwicklung und Lehre einwerben. Das F.A.Z.-Institut zeichnete das UKB im vierten Jahr in Folge als „Deutschlands Ausbildungs-Champion“ und „Deutschlands begehrtesten Arbeitgeber“ aus. Aktuelle Zahlen finden Sie im Geschäftsbericht unter: geschaeftsbericht.ukbonn.de.